Zurück zum personalisierten Management der atopischen Dermatitis
Die Pathogenese einer Neurodermitis ist komplex, auch scheint es keinen homogenen Phänotyp zu geben. Was ist der aktuelle Stand der Wissenschaft und welche therapeutischen Herausforderungen ergeben sich für die Zukunft?
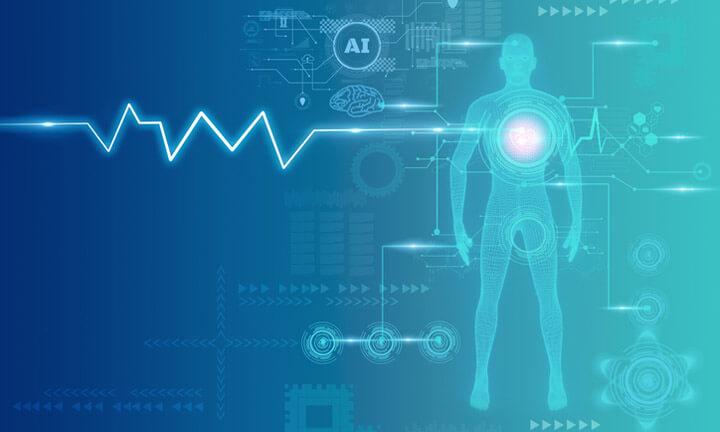
Im 19. Jahrhundert stand nach Meinung führender französischer Mediziner das Ekzem im Zentrum einer «Nebulosa» aus verschiedenen entzündlichen Hauterkrankungen. Bis in die 50er-Jahre gab es für die Behandlung der atopischen Dermatitis (AD) unzählige «Magistralrezepturen», die sich neben der Lokalisation auch an Zuständen wie akut/chronisch, trocken/nässend, infiziert oder steril orientierten.
«Dies sind für mich die Anfänge der personalisierten Medizin, ein Stück weit müssen wir dahin wieder zurückkommen», so Professor Dr. Thomas Bieber, Universitätsklinikum Bonn (1).
Genetik, Mikrobiom und Umwelt nehmen Einfluss
Mittlerweile hat man konkretere Vorstellungen von Pathophysiologie und Einflussgrössen wie (Epi-)Genetik, Umweltfaktoren, Hautbarrierefunktion und Mikrobiom. Beispielsweise spielen offenbar Staphylokokken vor allem bei Kindern eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Exazerbationen zu kontrollieren. «Unklar ist allerdings nach wie vor, wie viel Neuro tatsächlich in der Neurodermitis steckt», sagte Prof. Bieber. Heute begreift man die AD vor allem als immunologische Erkrankung, die sich in ihrer Dynamik und Komplexität z.B. deutlich von der Psoriasis unterscheidet. Beteiligt sind eine grosse Zahl von Mediatoren wie IL-13, IL-5 oder IL-4, die interagieren und eine TH2-Immunantwort vermitteln. Belegen lässt sich das postulierte Prinzip indirekt durch die positiven Effekte von neuartigen Therapieformen.
PDE4- und Januskinase-Inhibitoren zur topischen Behandlung sind in der Schweiz derzeit (noch) nicht zugelassen, aber in der systemischen Therapie gab es unlängst einen regelrechten Tsunami an Neuentwicklungen. Neben den Antikörpern Dupilumab und Tralokinumab kamen auch erste JAK-Inhibitoren auf den Markt: Baricitinib, Upadacitinib und Abrocitinib.
Während die Biologika sich gezielt gegen bestimmte Zytokine bzw. deren Rezeptoren richten, setzen die Small Molecules breiter an: Sie hemmen bis zu vier Januskinasen, die ihrerseits physiologisch an bis zu 20 Rezeptoren gebunden sind und unterschiedlichste Prozesse in der Zelle steuern.
Diese Multifunktionalität kann allerdings therapeutisch zur Gratwanderung werden, denn sie schmälert die Verträglichkeit der Wirkstoffe. «Die Substanzen beeinflussen nicht nur Mechanismen, die wir herunterregeln möchten (z.B. Entzündungsprozesse), sondern hemmen auch durchaus erwünschte Abläufe (wie Zelldifferenzierung)», räumte Prof. Bieber ein. Wirksamkeit und Toleranz der Substanzen sind unter anderem deshalb sehr unterschiedlich.
Daten der Biobank spiegeln Krankheitsverlauf
Im Vergleich aller aktuell für die AD zugelassenen Biologika und JAK-Inhibitoren (Monotherapie) erreichen bisher nur unter Upadacitinib 30 mg mehr als die Hälfte der Patienten (55 %) ein EASI-90-Ansprechen, die übrigen liegen irgendwo darunter. Bei keinem handelt es sich derzeit also um eine «Allzweckwaffe», meinte Prof. Bieber. Doch dabei muss es nicht bleiben. Aktuell sind mehr als 70 neue Substanzen mit unterschiedlichen Zielstrukturen in der Entwicklung. Gleichzeitig reift die Erkenntnis, dass verschiedene AD-Phänotypen eines individuellen Therapiealgorithmus bedürfen.
Um der AD und ihren Behandlungsmöglichkeiten weiter auf die Spur zu kommen, haben Prof. Bieber und Kollegen das CK-CARE-Register inklusive Biobank gegründet. Dieses umfasst mehr als 2.000 AD-Patienten zwischen 0 und 99 Jahren, für die eine Vielzahl von zusätzlichen Informationen vorliegen, darunter Blutergebnisse, Mikrobiom-Abstriche und Biopsate. Auswertungen mithilfe von Machine Learning und KI-Systemen haben bereits Interessantes zutage gefördert, fügte der Experte hinzu. So korreliert Analysen zufolge der Schweregrad der AD bei Erwachsenen mit dem Alter bei Krankheitsbeginn: Wer sehr früh erkrankt, hat als Erwachsener eher eine milde Form. Patienten mit adulter Form hingegen leiden meist unter schweren AD-Symptomen, zeigen jedoch weniger atopische Komorbiditäten.
Auch bei den Analysen zu IL-13, Periostin und DPP4 führten die Analysen zu überraschenden Ergebnissen. Bislang galt ein absoluter EASI von 16 in Studien und Leitlinien als Cut-off für ein ernsthaftes Krankheitsgeschehen. Doch offensichtlich ist die Wahrscheinlichkeit für hohe Markerwerte bereits bei deutlich niedrigeren EASI-Werten erhöht. «Ich bin überzeugt, dass der EASI 16 der falsche Wert ist. Anhand der Daten, die wir jetzt haben, sollte man wesentlich früher mit der systemischen Therapie anfangen», forderte Prof. Bieber.
Ein Zusammenhang zwischen der chronischen Hauterkrankung und Osteoporose liess sich über die RANK-Ligand- und OPG-Konzentrationen im Serum von volljährigen Patientinnen belegen. Frauen mit schwerer Dermatitis tragen demnach ein erhöhtes Risiko für Knochenläsionen und -brüche.
Die atopische Dermatitis frühzeitig stoppen
Zudem korrelieren bestimmte Biomarker mit den klassischen dermatologischen Atopie-Stigmata wie Hertoghe-Zeichen, periorbitale Verdunkelung, Dennie-Morgan-Zeichen, trockene Haut – und palmare Hyperlinearität. «Wir machen deshalb von unseren Patienten standardisierte Aufnahmen des Gesichts und der Handinnenflächen und lassen diese in der Biodatenbank mit den ganzen anderen Informationen zusammenlaufen.» Dann übernimmt die KI und heraus kommen z.B. Vorhersagen zum Subtyp oder dem potenziellen Therapieansprechen.
Prof. Biebers Vision für die Zukunft besteht darin, Mittel und Wege zu finden, um die AD frühzeitig zu stoppen, den atopischen Marsch zu verhindern und kardiovaskulären sowie neuropsychiatrischen Komorbiditäten vorzubeugen. Das meint nicht die Heilung, sondern eine «Disease Modification» auf Basis einer personalisierten Therapie. Diese kann bereits präventiv bei Säuglingen mit hohem Risiko ansetzen.
28. Fortbildungswoche für praktische Dermatologie und Venerologie