Ultra-Low-Dose-CT übertrifft Röntgen bei Kindern mit zystischer Fibrose
Radiologen und Radiologiefachkräfte würden ein Ultra-Low-Dose-CT einem konventionellen Röntgen-Thorax vorziehen, wenn es darum geht, Lungenschäden bei Kindern mit zystischer Fibrose zu beurteilen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie. Vorteile zeigten sich insbesondere bei Bildqualität und diagnostischer Sicherheit.
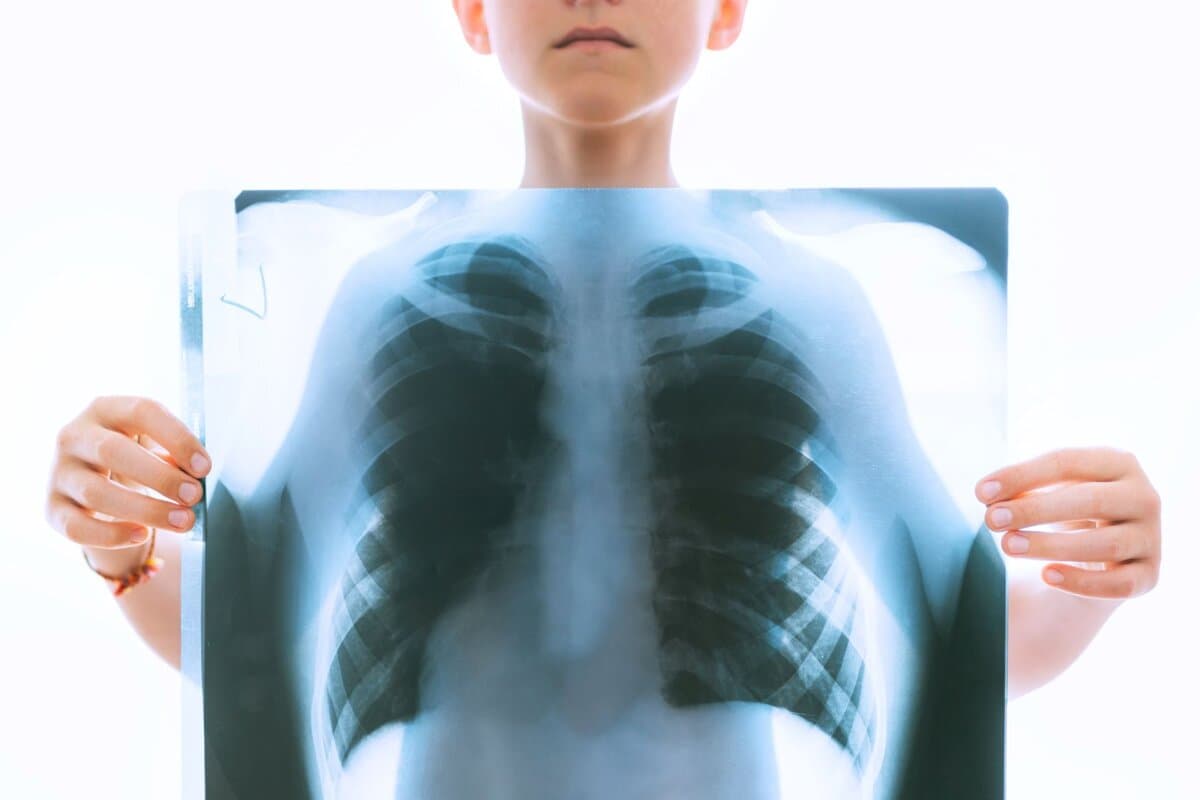
Die Bildgebung der Lunge ist bei der zystischen Fibrose (CF) ein zentrales diagnostisches Element. Denn strukturelle Lungenschäden beginnen bei CF-Betroffenen oft schon früh im Leben, und nur ein rechtzeitiger Behandlungsbeginn kann das Fortschreiten der Erkrankung verzögern.
Lange galt das Thorax-CT als Goldstandard; wegen der hohen Strahlenbelastung wird es aber zunehmend zurückhaltend eingesetzt. Eine aktuelle Studie hat nun untersucht, ob ein Ultra-Low-Dose-CT (ULDCT) mit Deep-Learning-gestützter Rekonstruktion den klassischen Röntgen-Thorax ersetzen kann.
CT mit Röntgen-ähnlicher Strahlendosis
Das Forscherteam um Dr. Niamh Moore vom irischen University College Cork führte bei 70 Kindern mit CF zwischen drei und 18 Jahren sowohl ein Röntgen als auch ein ULDCT des Thorax durch (1). Im Anschluss rekrutierte es 25 Radiologen und 50 Radiologiefachpersonen aus 24 Ländern, die jeweils zehn ausgewählte Bildpaare, aufgenommen im selben Zentrum, hinsichtlich Bildqualität und diagnostischer Sicherheit beurteilten. Über 86 % der Befragten verfügten dabei über umfangreiche, mittlere oder zumindest gewisse Erfahrung mit pädiatrischen CT-Aufnahmen, und waren daher mit der Bildqualität in dieser Patientengruppe vertraut.
88% der Befragten bevorzugten die Aufnahme mittels ULDCT gegenüber dem Röntgen. Zudem attestierten sie dem ULDCT eine signifikant bessere Bildqualität (p = 0,03), sowie eine höhere wahrgenommene diagnostische Sicherheit (p < 0,001). Bei Radiologen fielen diese Werte noch deutlicher aus. Anatomische Strukturen waren in beiden Verfahren ähnlich gut darstellbar. Die Bewertung für die Detailtiefe der krankhaften Veränderungen fiel im CT jedoch klar besser aus.
Bei der Aufnahme des ULDCT ermöglichte eine Deep-Learning-gestützte Rekonstruktion (DLIR) ein optimiertes Signal bei gleichzeitig geringer Strahlenbelastung. Die CT-Bilder wurden damit so verbessert, dass sowohl die Rauschstruktur als auch die anatomischen Details erhalten blieben. Die effektive Strahlendosis für ein ULDCT lag in der Studie bei rund 0,024 – 0,030 mSv, und bei 0,009 – 0,089 mSv für ein Röntgen – ein ähnlich niedriger Bereich. Zum Vergleich: die Strahlenbelastung bei einem klassischen Thorax-CT fällt mit 1,1 bis 7,5 mSv deutlich höher aus.
Längere Lebenserwartung erfordert Senken der Strahlenbelastung
Laut den Autoren könnte das ULDCT eine echte Alternative zum Röntgenthorax bei Kindern mit CF sein. Gerade weil CT-Bilder frühe Veränderungen wie Bronchiektasen, eine Verdickung der Bronchialwand oder Air-Trapping sichtbar machen, könnten sie helfen, eine Krankheitsprogression früh zu erkennen. Zu diesem Zeitpunkt fehlen klinische Anzeichen der Erkrankung oft noch völlig, und funktionelle Parameter wie das forcierte exspiratorische Volumen in 1 Sekunde (FEV1) sind noch unauffällig.
Seit der Einführung der CFTR-Modulatoren im Jahr 2012 haben sich die Überlebenschancen und die Lebensqualität von Patienten mit CF deutlich verbessert. Aber auch die neuen Therapien können bereits eingetretene strukturelle Veränderungen wie Bronchiektasen nicht mehr rückgängig machen. Eine Früherkennung beginnender Lungenschäden und rechtzeitige Therapie ist daher entscheidend.
Für die Praxis fordern die Forschenden auch eine Standardisierung der CT-Protokolle, um Bildqualität und Strahlendosis weiter zu optimieren. Angesichts der mittlerweile hohen Lebenserwartung von CF-Patienten sei es entscheidend, die kumulative Strahlendosis so weit wie möglich zu reduzieren. Dies gilt insbesondere angesichts der erhöhten Inzidenz von Krebserkrankungen bei den Betroffenen – darunter Tumoren des Gastrointestinaltraktes.
- Moore N et al. Image quality in ultra-low-dose chest CT versus chest x-rays guiding paediatric cystic fibrosis care. Eur Radiol. 2025 Jul 25. doi: 10.1007/s00330-025-11835-3.
